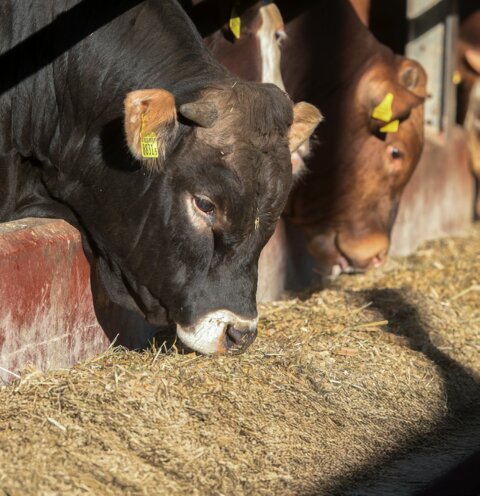Die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion wird zu einem Grossteil durch die Futtereffizienz bestimmt. Die Futtereffizienz beschreibt, wie gut die Kuh das aufgenommene Futter in Milch umwandeln kann. Hier spielen diverse Faktoren eine Rolle. Wichtige Einflussfaktoren sind unter anderem die Rasse, klimatische Bedingungen, das Fütterungs- und Melkmanagement, die Herdengesundheit und die Zusammensetzung der Ration. Insbesondere das Verhältnis zwischen Energie und Protein spielt in Bezug auf die Zusammensetzung der Ration eine entscheidende Rolle.
Quer gelesen
- Ab einem durchschnittlichen RP-Gehalt der Gesamtration von unter 135 g RP / kg TS sinkt die Leistung.
- Ist die Proteinversorgung zu hoch, kann das negative Auswirkungen auf den Stoffwechsel, die Fruchtbarkeit und die Umwelt haben.
- Der optimale Rohproteingehalt der Gesamtration liegt je nach Milchleistung zwischen 145 und 165 g / kg TS.
Proteinversorgung genau abstimmen
Eine nicht angepasste Proteinversorgung hat negative Folgen. Bei einer Unterversorgung sind nicht nur tiefe Harnstoffwerte zu erwarten. Der TS-Verzehr sinkt ebenfalls und die Pansenmikroben können ihr Leistungspotenzial nicht vollständig ausschöpfen. Beides beeinflusst die Milchleistung negativ. Dies konnte in mehreren Studien gezeigt werden. Eine Studie aus den Niederlanden, wo die Stickstoffversorgung sehr streng limitiert ist, zeigt, dass ab einem durchschnittlichen Rohproteingehalt der gesamten Ration von unter 135 g RP / kg TS der TS-Verzehr signifikant abnimmt. Das wirkt sich direkt auf die Milchleistung aus. Die Harnstoffgehalte lagen dabei bei 9 mg / dl. Zudem sinkt die Faserverdaulichkeit bei einer zu tiefen Proteinzufuhr, was wiederum die Energieversorgung negativ beeinflusst. Besonders bei Schweizer Rationen ist die Faserverdauung ein wichtiger Faktor. Je effizienter die Fasern verdaut werden, desto besser wird das Grundfutter verwertet. Eine verbesserte Grundfutterverwertung steigert die Futtereffizienz und erhöht damit die Energieversorgung – mit positivem Effekt auf die Milchleistung.
Eine gezielte Proteinversorgung sichert Leistung und Gesundheit.
Obschon das Bewusstsein für eine angepasste Proteinversorgung gestiegen ist, gibt es nach wie vor Betriebe, die Potenzial für eine Proteinreduktion haben. Besonders Betriebe mit weidebasierten Fütterungssystemen weisen in den Herbstmonaten teilweise sehr hohe Harnstoffwerte in der Milch auf. Eine Überversorgung an Protein ist nicht nur problematisch für die Umwelt, sondern kann auch die Tiergesundheit negativ beeinflussen. Die Leber wird unnötig belastet, weil der überschüssige Ammoniak aus dem Pansen zu Harnstoff umgewandelt werden muss. Zudem ist erwiesen, dass hohe Harnstoffwerte im Stoffwechsel fetotoxisch sind, also zu embryonalem Frühtod führen können. Somit wird auch die Fruchtbarkeit negativ beeinflusst.
Modelle für die Zukunft
Dass eine möglichst ausgeglichene Ration nach Protein und Energie sinnvoll für Klima, N-Effizienz, Futtereffizienz sowie Tiergesundheit und -leistung ist, steht ausser Frage. Eine effiziente Proteinversorgung erfordert mehr als nur die Optimierung des Rohproteingehalts der Ration. Auch der Anteil an schnell fermentierbarem Protein und wirklich im Dünndarm verfügbarem Protein hilft, die Proteineffizienz zu steigern. Altbewährte Parameter wie das APD-System geraten zunehmend unter Druck, da die Genauigkeit im Vergleich zu den oben genannten Parametern geringer ist. Darüber hinaus lässt sich mit geeigneten Komponenten der Proteingehalt der Gesamtration reduzieren, ohne dass negative Folgen zu erwarten sind. Der Einsatz von pansengeschützten Aminosäuren ist eine Möglichkeit, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Da die Aminosäuren, welche grundsätzlich das Produkt des Proteinabbaus sind, direkt gefüttert werden, lässt sich der Rohproteingehalt der Gesamtration auf bis zu 145 g RP / kg TS senken, ohne dass mit einer Reduktion der Milchleistung gerechnet werden muss. Der optimale Rohproteingehalt der Gesamtration liegt je nach Milchleistung zwischen 145 und 165 g / kg TS.
Wie viel Eiweiss brauchen Hochleistungskühe wirklich?
Können Hochleistungskühe auch bei minimaler Eiweisszufuhr, sprich mit einem Milchharnstoffgehalt von unter 10 mg / dl, gleich viel und ebenso wirtschaftlich Milch produzieren wie Kühe, die nach gängiger Praxis mit Eiweiss (Milchharnstoff 15 – 25 mg / dl) versorgt werden?
Zur Klärung dieser Frage wurde auf der Swiss Future Farm in Tänikon ein viermonatiger Fütterungsversuch durch geführt. Die Herde wurde dazu in zwei Gruppen aufgeteilt. In der ersten Gruppe «Tiefeiweiss-Ration» soll ein Milchharnstoffgehalt unter 10 mg / dl erreicht werden. Die zweite Gruppe «W-FOS-Ration» erhielt eine nach W-FOS optimierte Ration, wie sie auf anderen Praxisbetrieben umgesetzt wird.
Beide Rationen basierten auf der gleichen Grundration, welche sich aus 42 % Maissilage, 38 % Grassilage, 5 % Dürrfutter und 5 % Zuckerrübenschnitzel zusammensetzte. Die «Tiefeiweiss-Ration» wurde mit 1,5 kg Getreidemischung sowie einem Zusatzstoff für eine bessere Proteineffizienz ergänzt, die «W-FOS-Ration» mit 1,5 kg Eiweisskonzentrat.
Beide Gruppen wurden je zwei Monate mit ihrer jeweiligen Ration gefüttert, danach wurden die Rationen getauscht und der Versuch zwei weitere Monate fortgeführt. Alle zwei Wochen erfolgten Milchwägungen. Zudem wurden Grund- und Kraftfutterverzehr mittels Mischwagenprotokoll und Melkroboterdaten erfasst, um die Futterkosten pro Kilogramm Milch zu berechnen.
Leistungseinbussen bei tiefem Harnstoffgehalt
Der Fütterungsversuch auf der Swiss Future Farm zeigt klar: Hochleistungskühe mit einem Milchharnstoffgehalt von unter 10 mg / dl haben nicht nur eine tiefere Milchleistung und tiefere Eiweissgehalte, sondern auch einen niedrigeren Verzehr. Mit der «W-FOS-Ration» stieg die Milchleistung nach dem Rationswechsel um sieben Kilogramm pro Kuh und Tag. Im Schnitt wurden über den gesamten Versuch hinweg mit der «W-FOS-Ration» vier Kilogramm ECM pro Tier und Tag mehr produziert. Auch bei den Milchinhaltsstoffen zeigten sich Unterschiede: Bei der «Tiefeiweiss-Ration» sanken die Eiweissgehalte, während sie bei der «W-FOS-Ration» tendenziell anstiegen. Eindrücklich ist, dass der Trockensubstanzverzehr bei der «W-FOS -Ration» durchgehend höher war. Über den gesamten Versuch waren es im Schnitt zwei Kilogramm TS pro Kuh und Tag, die mehr gefressen wurden, obwohl die Futterkosten pro Kilogramm Milch bei der «W-FOS-Ration» über den ganzen Versuch drei Rappen tiefer lagen. Dies aufgrund der höheren Milchleistung.
Zudem wurden während des Versuches bei der «Tiefeiweiss-Ration» Anzeichen für eine ungenügende Versorgung wie Harnsaufen sichtbar. Mittels Kotauswaschung wurde ausserdem ersichtlich, dass die Futterverwertung bei der «Tiefeiweiss-Ration» tiefer war. Eine gezielte Eiweissergänzung erweist sich daher nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch im Sinne des Tierwohls als sinnvoll und notwendig.